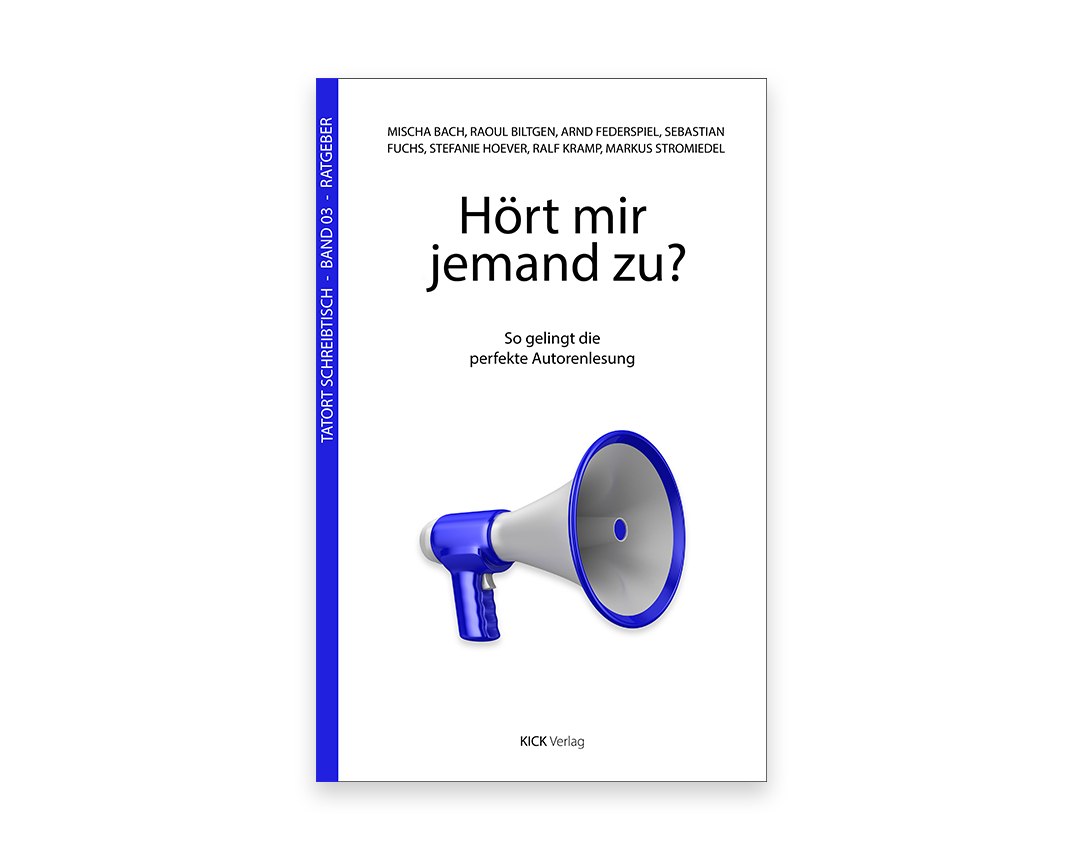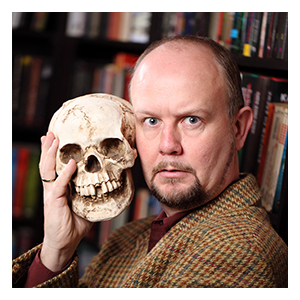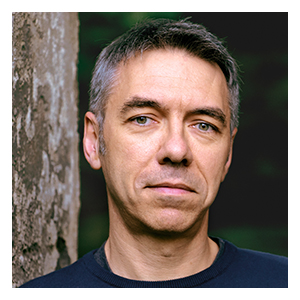Ein Buch schreiben ist eine Sache – vor Publikum daraus vorlesen eine
ganz andere. Wer schon einmal auf einer Lesebühne gestanden hat, der
weiß, was alles bei einer Autorenlesung schief gehen kann. Doch es ist
nicht nötig, alle schlechten Erfahrungen selbst zu machen...
Sieben
ausgewiesene Profis auf ihrem Gebiet berichten in diesem Buch von ihrem
Weg zur perfekten Lesung und verraten ihre ganz persönlichen Tricks, die
sowohl für Anfänger als auch für Lesungsprofis hilfreich sind - mit
Tipps und Checklisten für Autoren, Buchhändler und Bibliotheken-
ISBN 9783946312185
Paperback, 312 Seiten
Print-Ausgabe: 24 € (A: 24,80 €)
E-Book: 19,99 €
Buch kostenlos lesen
E-Book ohne Anmeldung kaufen
Die Autoren sind: 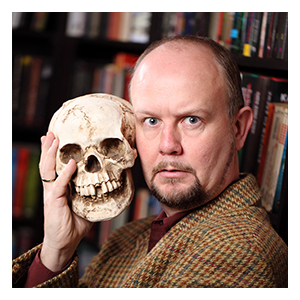 Ralf Kramp
Ralf Kramp, Krimiautor in der Eifel, ist mit inzwischen mehr als 1500
Lesungen einer der profiliertesten Vorleser Deutschlands. Kramps
Auftritte sind legendär, und Veranstalter wie Publikum lieben ihn
gleichermaßen.
 Sebastian Fuchs
Sebastian Fuchs ist Sprecher, Sprechtrainer und langjähriger Dozent für
Sprecherziehung an der Schauspielschule „Ernst Busch“. Er brilliert als
Sprechvirtuose und kennt alle Kniffe, auf der Bühne nicht die Stimme zu
verlieren.
 Raoul Biltgen
Raoul Biltgen ist nicht nur Autor, sondern auch Schauspieler und
Psychotherapeut. Sein Wissen aus diesen drei Professionen vereint er in
diesem Buch und weist einen Weg, im Rampenlicht vor Leuten zu überleben.
 Mischa Bach
Mischa Bach und
Arnd Federspiel sind 2/3 des Essener
Krimi-Überfallkommandos und als Autoren erfahrene Lesungs-Dramatiker.
Sie kennen die Tücken der Praxis und wissen, wie gute Textarbeit vor
einer Lesung hilft.
 Stefanie Hoever
Stefanie Hoever von der Mayerschen Buchhandlung in Aachen organisiert
mit ihrem Team pro Jahr rund 500 - 600 Lesungen und schöpft aus einem
reichen Erfahrungsschatz, von dem nicht nur Buchhändler profitieren.
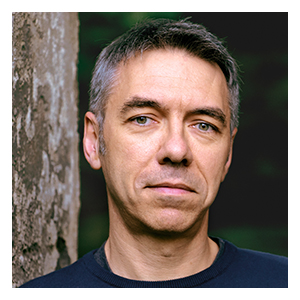 Markus Stromiedel
Markus Stromiedel ist seit mehr als 25 Jahren Autor und Drehbuchautor, in
dieser Zeit entstanden sieben Romane und mehr als 40 verfilmte Drehbücher.
Aus seiner Feder stammt zum Beispiel die Figur des Kieler
Tatort-Kommissars "Klaus Borowski".
© Autorenfotos: Bianca Kübler (Foto Raoul Biltgen), Stephan von Knobloch (Foto Mischa Bach und Arndt Federspiel), Fotostudio Berns (Foto Stefanie Hoever), Jörg Schwalfenberg (Foto Markus Stromiedel)