Schreibregel der Woche

© Autorenfoto: Hocky Neubert
Ich träumte bereits während meiner Schulzeit davon, Schriftsteller zu werden und Romane zu schreiben. Trotzdem dauerte es lange, bis ich diesen Plan ernsthaft in Angriff nahm. Als endlich mein erster Roman erschien, war ich schon ein Mittdreißiger...
Diese Verzögerung lag an zunächst anderweitig eingeschlagenen Berufswegen. Aber nicht nur. Zwischendurch unternahm ich nämlich ein paar Anläufe, längere Geschichten oder einen Roman zu schreiben. Und scheiterte ein ums andere Mal damit. Wenn Sie meinen Roman „Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …“ gelesen haben, wissen Sie, wovon ich rede.
Und das, obwohl ich seit früher Kindheit an jedes Buch, das mir unter die Finger kam, förmlich verschlang und mir einbildete, allein schon deshalb etwas von Literatur zu verstehen. Wenigstens in einer Hinsicht war mein immenser Bücherkonsum auch für die eigenen literarischen Ambitionen von Nutzen: Ich hatte den Vergleich und erkannte, dass fast alles, was ich selbst schrieb, diesem Vergleich nicht stand hielt. Jedenfalls in meinen Augen, und das war für mich ausschlaggebend (siehe auch: die „Knallkowski-Regel, also die Regel Nr. 7)
Also lief mein Schriftsteller-Traum in der Warteschleife, während ich derweil: lebte.
Fantasie ist etwas Großartiges. Man kann sich eine Menge Sachen ausdenken. Und selbstverständlich ist es für Geschichtenerfinder wichtig, über viel Fantasie zu verfügen.
Letzten Endes liefert aber meist das Leben selbst die Blaupause für die Geschichten, die, aufbereitet durch die kreative Arbeit einer Autorin oder eines Autors, in einem Buch, in einem Film oder in welchem Medium auch immer erzählt werden. Deshalb lautet mein selbstformuliertes Basisrezept für Autoren:
Leben, lange leben und viel erleben.
Ja, natürlich gibt es sie, die „Wunderkinder“, auch in der Literatur. Geniale Überflieger, die hochgelobte Debüt-Romane vorlegen, während ihre Altersgenossen vielleicht gerade erst den Führerschein machen. Die haben noch gar nicht viel erlebt und schreiben trotzdem virtuos darüber.
Wir übrigen, denen so ein rasanter Frühstart nicht vergönnt war, müssen uns dennoch nicht als die schlechteren Autoren fühlen. Denn wir alle – die Literaturwunderkinder, die langgedienten Schreibprofis, die spätberufenen Anfänger – verfassen lediglich als ausführendes Personal die Geschichten, die eigentlich das Leben geschrieben hat.
Spannend ist dabei, dass sich nie absehen lässt, ob nicht vielleicht Ihr nächster Roman der beste ist, der jemals geschrieben wurde. Und das Allerschönste für alle, die vielleicht erst jetzt ernsthaft in Erwägung ziehen, es selbst einmal mit dem Schreiben zu versuchen: Man kann jederzeit Autor werden, sogar jederzeit ein erfolgreicher. Für schriftstellerische Tätigkeit gibt es weder ein Mindestalter noch eine Altersbegrenzung.
Es ist nie zu früh oder zu spät dafür.
Sie möchten einen Roman schreiben? Das Drehbuch für einen Film? Ein Gedicht, einen Songtext oder „nur“ eine Kurzgeschichte? Sie haben betörende Bilder im Kopf? Action, Romantik, Witz und Drama? Möglicherweise haben Sie selbst oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis etwas erlebt, und alle – Sie vor allem – kommentieren das spontan: „Da könnte man ja glatt ein Buch draus machen!“
Dann machen Sie mal.
Jetzt wissen Sie ja, wie das geht.
Diese Regel stammt aus dem Tatort-Schreibtisch-Buch:
Jan Schröters "Goldene Schreibregeln" - 22 Tipps für Autoren und alle, die es werden wollen
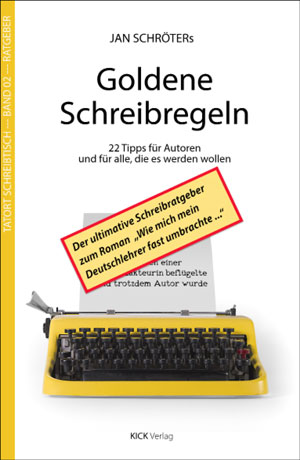
Die Mailadresse lautet
Mehr Infos über das Buch "Goldene Schreibregeln"
E-Book ohne Anmeldung kaufen
Autorenportrait von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
Das Leben hat viel mehr Fantasie als du. Willst du schreiben: Lebe.
von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
Ich träumte bereits während meiner Schulzeit davon, Schriftsteller zu werden und Romane zu schreiben. Trotzdem dauerte es lange, bis ich diesen Plan ernsthaft in Angriff nahm. Als endlich mein erster Roman erschien, war ich schon ein Mittdreißiger...
Diese Verzögerung lag an zunächst anderweitig eingeschlagenen Berufswegen. Aber nicht nur. Zwischendurch unternahm ich nämlich ein paar Anläufe, längere Geschichten oder einen Roman zu schreiben. Und scheiterte ein ums andere Mal damit. Wenn Sie meinen Roman „Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …“ gelesen haben, wissen Sie, wovon ich rede.
Und das, obwohl ich seit früher Kindheit an jedes Buch, das mir unter die Finger kam, förmlich verschlang und mir einbildete, allein schon deshalb etwas von Literatur zu verstehen. Wenigstens in einer Hinsicht war mein immenser Bücherkonsum auch für die eigenen literarischen Ambitionen von Nutzen: Ich hatte den Vergleich und erkannte, dass fast alles, was ich selbst schrieb, diesem Vergleich nicht stand hielt. Jedenfalls in meinen Augen, und das war für mich ausschlaggebend (siehe auch: die „Knallkowski-Regel, also die Regel Nr. 7)
Also lief mein Schriftsteller-Traum in der Warteschleife, während ich derweil: lebte.
Fantasie ist etwas Großartiges. Man kann sich eine Menge Sachen ausdenken. Und selbstverständlich ist es für Geschichtenerfinder wichtig, über viel Fantasie zu verfügen.
Letzten Endes liefert aber meist das Leben selbst die Blaupause für die Geschichten, die, aufbereitet durch die kreative Arbeit einer Autorin oder eines Autors, in einem Buch, in einem Film oder in welchem Medium auch immer erzählt werden. Deshalb lautet mein selbstformuliertes Basisrezept für Autoren:
Leben, lange leben und viel erleben.
Ja, natürlich gibt es sie, die „Wunderkinder“, auch in der Literatur. Geniale Überflieger, die hochgelobte Debüt-Romane vorlegen, während ihre Altersgenossen vielleicht gerade erst den Führerschein machen. Die haben noch gar nicht viel erlebt und schreiben trotzdem virtuos darüber.
Wir übrigen, denen so ein rasanter Frühstart nicht vergönnt war, müssen uns dennoch nicht als die schlechteren Autoren fühlen. Denn wir alle – die Literaturwunderkinder, die langgedienten Schreibprofis, die spätberufenen Anfänger – verfassen lediglich als ausführendes Personal die Geschichten, die eigentlich das Leben geschrieben hat.
Spannend ist dabei, dass sich nie absehen lässt, ob nicht vielleicht Ihr nächster Roman der beste ist, der jemals geschrieben wurde. Und das Allerschönste für alle, die vielleicht erst jetzt ernsthaft in Erwägung ziehen, es selbst einmal mit dem Schreiben zu versuchen: Man kann jederzeit Autor werden, sogar jederzeit ein erfolgreicher. Für schriftstellerische Tätigkeit gibt es weder ein Mindestalter noch eine Altersbegrenzung.
Es ist nie zu früh oder zu spät dafür.
Sie möchten einen Roman schreiben? Das Drehbuch für einen Film? Ein Gedicht, einen Songtext oder „nur“ eine Kurzgeschichte? Sie haben betörende Bilder im Kopf? Action, Romantik, Witz und Drama? Möglicherweise haben Sie selbst oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis etwas erlebt, und alle – Sie vor allem – kommentieren das spontan: „Da könnte man ja glatt ein Buch draus machen!“
Dann machen Sie mal.
Jetzt wissen Sie ja, wie das geht.
Diese Regel stammt aus dem Tatort-Schreibtisch-Buch:
Jan Schröters "Goldene Schreibregeln" - 22 Tipps für Autoren und alle, die es werden wollen
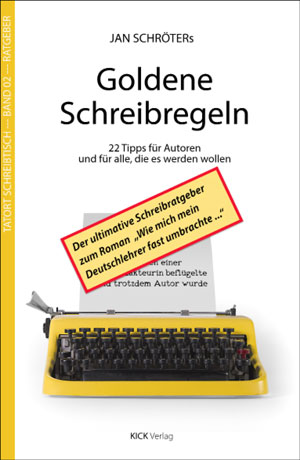
Wenn Sie das Buch bestellen möchten, schicken wir Ihnen das Buch versandkostenfrei zu.
Mailen
Sie uns einfach Ihre Bestellung zusammen mit Ihrer Anschrift und Ihrer
Kontoverbindung (IBAN) zu, wir buchen den Rechnungsbetrag von Ihrem
Konto ab. Alternativ bekommen Sie von uns eine Rechnung, damit Sie uns
den Betrag überweisen können.
E-Book ohne Anmeldung kaufen
Autorenportrait von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
weiterlesen
weniger
