Schreibregel der Woche

© Autorenfoto: Hocky Neubert
Manchmal fehlen einem glatt die Worte. Die Konfrontation mit bodenloser Frechheit, der Anblick atemberaubender Schönheit, es gibt viele Gründe für akute Sprachlosigkeit. Das Gefühl ist schneller als der Geist. Man empfindet eine Wirkung und kann im Sekundenbruchteil ahnen, ob das positiv oder negativ ist. Warum genau das so ist, erfasst man oft nicht. Eine präzise formulierte Beschreibung dieser Empfindung könnte einem helfen, sie noch besser zu verstehen...
Nichts und niemand ist unbeschreiblich
von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
Manchmal fehlen einem glatt die Worte. Die Konfrontation mit bodenloser Frechheit, der Anblick atemberaubender Schönheit, es gibt viele Gründe für akute Sprachlosigkeit. Das Gefühl ist schneller als der Geist. Man empfindet eine Wirkung und kann im Sekundenbruchteil ahnen, ob das positiv oder negativ ist. Warum genau das so ist, erfasst man oft nicht. Eine präzise formulierte Beschreibung dieser Empfindung könnte einem helfen, sie noch besser zu verstehen...
Oder seinen Mitmenschen zu vermitteln, was genau man gerade empfunden
hat, damit sie diese Empfindung teilen können. Leider hat es einem in
diesem Augenblick die Sprache verschlagen. Und schon ist der Moment
vorbei. Der nächste Eindruck, die nächste Empfindung drängt sich in den Lebensvordergrund, und weiter geht’s, im Sauseschritt.
Mittlerweile führt beinahe jeder ein Mobiltelefon mit Kamerafunktion bei sich, ständig und überall. Klick – schon ist ein Foto vom Sonnenuntergang, von Sohnemann am Strand oder einer wilden Müllhalde gemacht. Klick, Klick – schon bricht die Bilderflut via Snapchat, Instagramm, WhattsApp und ähnlichen Portalen über die Mitmenschen herein, die sich alle ihren persönlichen Reim darauf machen. Was sie sehen, ist:
- ein Sonnenuntergang
- ein kleiner Junge am Strand
- eine wilde Müllhalde
Und schon glauben alle, sie wüssten Bescheid. Was sie allerdings nicht sehen, ist:
- wie Ihnen angesichts des untergehenden Tages dessen Unwiederbringlichkeit bewusst wurde und Sie diese Feststellung trotzdem kein bisschen ängstigte, weil in diesem stillen Naturschauspiel so viel Trost und Frieden lag
- wie selbstvergessen Ihr kleiner Knirps im Sand herumbuddelt, so glücklich im Hier und Jetzt, dass es Sie zu Tränen rührte
- wie Ihnen der bestialische Gestank der wilden Müllkippe bereits den Atem geraubt hat, bevor sie überhaupt in Sicht kam
Eindrücke und Gefühle, Eigenschaften und Charakterfeinheiten lassen sich viel besser mit Worten beschreiben als irgendwie sonst. Präzise Sprache vermittelt die Botschaft des Schreibers punktgenau. So gelingt es ausgezeichnet, andere Menschen darüber ins Bild zu setzen. Oft sogar besser, als würde man ihnen ein Bild davon zeigen. Denn auf einem Foto sind auch meistens ein paar Dinge, die gar nichts mit dem zu tun haben, was der Fotograf eigentlich festhalten wollte. Zum Beispiel ist beim Sonnenuntergang-Foto zwar die spektakulär leuchtende Sonne zu sehen, aber der Horizont hängt schief und vorne links läuft ein Dackel über die Wiese. Schon denkt der Betrachter über den Horizont oder den Hund nach, dabei hat der Fotograf beides im Augenblick der Aufnahme weder beachtet noch gemeint.
Es kommt eben nicht darauf an, möglichst viele Details in eine Botschaft zu packen. Die Kunst einer präzisen Beschreibung liegt in der Beschränkung aufs Wesentliche. Und zwar auf das, was der Beschreiber in diesem Fall für wesentlich hält.
Wer eine Geschichte oder gar einen ganzen Roman schreiben möchte, wird sich dafür Haupt- und Nebenfiguren einfallen lassen. Diese sollen mit ihrer fiktiven Persönlichkeit die Handlung tragen und die Leser an die Lektüre fesseln. Das klappt am besten, wenn die Leser eine Romanfigur als individuellen Charakter wahrnehmen und akzeptieren, im Idealfall schon beim ersten Auftreten.
Aber wie schafft man das?
Indem man sich als Autor zunächst davon verabschiedet, möglichst im ersten Absatz schon eine komplette Personenbeschreibung liefern zu wollen. Weitschweifige Informationen von Haarfarbe bis Schuhgröße taugen für steckbriefliche Fahndungen, beseelen aber keine Romanfigur. Plakative Attribute wie „Sie war eine kluge Frau“ oder „Er sah sehr gut aus“ helfen auch nicht weiter, weil so etwas bloße Behauptungen sind, die erst mit Leben gefüllt werden wollen.
Die Bindung an die Figur stellt sich ein, wenn in ihrem Auftritt ihre Befindlichkeit zum Vorschein kommt. Wenn sich sofort Einblicke in ihren Charakter ergeben, originelle Wesenszüge erkennen lassen. Dann fühlt sich der Betrachter in die Figur ein und sie verliert ihre Künstlichkeit. Wenn das passiert, wird aus der fiktiven Gestalt rasch ein guter Bekannter. Es interessiert einen, wie es mit dem weitergeht.
Ich möchte Ihnen anhand von drei Beispielen zeigen, wie sich eine Romanfigur etablieren lässt. Diese Beispiele sind meinen eigenen Romanen entnommen – nicht, weil ich mich für den Größten meiner Zunft hielte, sondern um urheberrechtliche Querelen zu vermeiden.
Alle drei Beispiele benutzen die äußere Erscheinung der Figur, um sich zu ihrer Persönlichkeit durchzuarbeiten:
„Gertrud Holle rauschte herein wie eine Fregatte unter Volldampf, gefühlte Wasserverdrängung tausend Tonnen. Die Figur tornadosicher mit einer Überdosis Festiger betoniert. Glitzernde Schweinsäuglein unter sorgsam gezupften Brauen. Dezentes Kostüm in Hanseatenblau, Perlenbrosche und Lacktäschchen. Schwer bemüht, bis ins letzte Detail akkurat und ordentlich zu wirken – so ordentlich, dass ich sie am liebsten mit Sagrotan aus der Kulisse gewischt hätte.“
„Eine kleine Person wirbelte herein. Eigentlich ging sie normal geradeaus wie andere Menschen auch. Trotzdem sah es immer so aus, als hielte ein innerer Tornado Merle Striebeck permanent auf voller Drehzahl – hart am roten Bereich. Wahrscheinlich führte diese Binnenrotation zu einer Sogwirkung, die vor allem in Erscheinung trat, sobald Merle ihren Kleiderschrank öffnete. Die Klamotten flogen ihr dann um den Leib wie Eisenfeilspäne an einen Magneten. Anders war die Farb- und Stilkombination ihrer Bekleidung kaum zu erklären. Merle trug grundsätzlich an beiden Füßen unterschiedliche Socken, besaß eine Schwäche für neonfarbene Accessoires und bevorzugte bei Stoffen stets die schrillste Variante. Auch in ihrem momentanen Outfit hätte Merle jederzeit auf der Autobahn eine Nachtbaustelle einrichten können, ohne überfahren zu werden.“
„Vor mir stand plötzlich eine junge Frau. Rote Haare mit einer missglückt eingefärbten Grünsträhne, die gnädigerweise bereits verblasste. Ihre Kleidung stammte offensichtlich nicht aus dem guten Hause eines angesagten Designers und saß nicht besonders gut, was auch an einigen Pfunden Übergewicht liegen mochte, die sie mit sich herum trug. Winzige Fältchen um Mund und Augen erzählten mir, dass sie gerne lachte. Etwas in ihrem Blick besagte, dass es für sie gerade nicht viel zu lachen gab.“
Aus diesen Beschreibungen liest man den Charakter der Figuren. Nummer 1 ist ein berechnender, durchsetzungskräftiger Mensch. Nummer 2 eine anstrengende, chaotische, aber nicht böswillige Persönlichkeit. Nummer 3 signalisiert Widersprüchlichkeiten und Seelentiefe. Das ist in den Beispielpassagen nicht ausdrücklich genannt, aber man spürt es beim Lesen (so hoffe ich zumindest…).
Man kann eine Figur auch einführen, indem man sie etwas tun lässt, was ein Schlaglicht auf ihren Charakter wirft. So etwas funktioniert in Büchern, vor allem aber auch in Filmen sehr gut. Zum Beispiel in so einer Szene:
Ein Mann tritt in eine unaufgeräumte Küche, um sich Kaffee zu kochen. Er sucht in diversen Schränken, findet jedoch keinen. Kurzentschlossen öffnet er den knallvollen Abfalleimer, kramt den benutzten Filter von gestern aus dem Müll und brüht damit neuen Kaffee auf. Schon wissen wir: Dieser Mann führt kein geregeltes Leben, nimmt es jedoch pragmatisch.
Die dritte Möglichkeit einer Figuren- Charakterisierung im Roman oder Film bietet der Dialog. Überlegen Sie sich schon vor Schreibbeginn, welche Art Sprache und welche Sprüche zu Ihrem Romanhelden passen. Dann gelingen Ihnen vielleicht auch so stimmige Dialoge wie die im Film-Klassiker „Casablanca“, mit denen sich der von Humphrey Bogart gespielte Nachtclubbesitzer Rick Blaine sich sofort als unerschütterlicher Zyniker etabliert:
„Welche Nationalität haben Sie?“
Antwort Blaine: „Ich bin Trinker.“
Oder: „Vergessen Sie nicht, die Pistole ist genau auf Ihr Herz gerichtet.“
Antwort Blaine: „Da bin ich am wenigsten verwundbar.“
Fehlen Ihnen zunächst die Worte, räumen Sie sich mehr Zeit dafür ein, Ihre Sprache zu finden. Es gibt so unfassbar viele unterschiedliche Beschreibungsmöglichkeiten für alles und jeden. Wenn Sie lange genug darüber nachdenken, finden Sie für jedes Bild, jede Empfindung, jede Figur eine Formulierung, die Ihrer schöpferischen Absicht entspricht und mit der Sie sich wohl fühlen. Ist das noch nicht ganz der Fall, lohnt es sich immer, noch ein wenig länger darüber nachzudenken, denn:
Nichts und niemand ist unbeschreiblich.
Diese Regel stammt aus dem Tatort-Schreibtisch-Buch:
Jan Schröters "Goldene Schreibregeln" - 22 Tipps für Autoren und alle, die es werden wollen
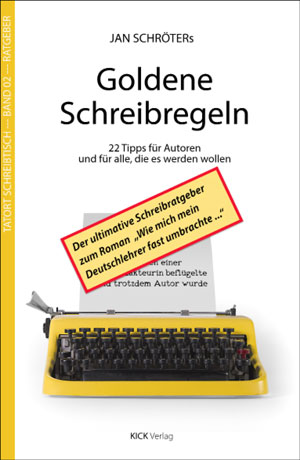
Die Mailadresse lautet
Mehr Infos über das Buch "Goldene Schreibregeln"
E-Book ohne Anmeldung kaufen
Autorenportrait von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
Mittlerweile führt beinahe jeder ein Mobiltelefon mit Kamerafunktion bei sich, ständig und überall. Klick – schon ist ein Foto vom Sonnenuntergang, von Sohnemann am Strand oder einer wilden Müllhalde gemacht. Klick, Klick – schon bricht die Bilderflut via Snapchat, Instagramm, WhattsApp und ähnlichen Portalen über die Mitmenschen herein, die sich alle ihren persönlichen Reim darauf machen. Was sie sehen, ist:
- ein Sonnenuntergang
- ein kleiner Junge am Strand
- eine wilde Müllhalde
Und schon glauben alle, sie wüssten Bescheid. Was sie allerdings nicht sehen, ist:
- wie Ihnen angesichts des untergehenden Tages dessen Unwiederbringlichkeit bewusst wurde und Sie diese Feststellung trotzdem kein bisschen ängstigte, weil in diesem stillen Naturschauspiel so viel Trost und Frieden lag
- wie selbstvergessen Ihr kleiner Knirps im Sand herumbuddelt, so glücklich im Hier und Jetzt, dass es Sie zu Tränen rührte
- wie Ihnen der bestialische Gestank der wilden Müllkippe bereits den Atem geraubt hat, bevor sie überhaupt in Sicht kam
Eindrücke und Gefühle, Eigenschaften und Charakterfeinheiten lassen sich viel besser mit Worten beschreiben als irgendwie sonst. Präzise Sprache vermittelt die Botschaft des Schreibers punktgenau. So gelingt es ausgezeichnet, andere Menschen darüber ins Bild zu setzen. Oft sogar besser, als würde man ihnen ein Bild davon zeigen. Denn auf einem Foto sind auch meistens ein paar Dinge, die gar nichts mit dem zu tun haben, was der Fotograf eigentlich festhalten wollte. Zum Beispiel ist beim Sonnenuntergang-Foto zwar die spektakulär leuchtende Sonne zu sehen, aber der Horizont hängt schief und vorne links läuft ein Dackel über die Wiese. Schon denkt der Betrachter über den Horizont oder den Hund nach, dabei hat der Fotograf beides im Augenblick der Aufnahme weder beachtet noch gemeint.
Es kommt eben nicht darauf an, möglichst viele Details in eine Botschaft zu packen. Die Kunst einer präzisen Beschreibung liegt in der Beschränkung aufs Wesentliche. Und zwar auf das, was der Beschreiber in diesem Fall für wesentlich hält.
Wer eine Geschichte oder gar einen ganzen Roman schreiben möchte, wird sich dafür Haupt- und Nebenfiguren einfallen lassen. Diese sollen mit ihrer fiktiven Persönlichkeit die Handlung tragen und die Leser an die Lektüre fesseln. Das klappt am besten, wenn die Leser eine Romanfigur als individuellen Charakter wahrnehmen und akzeptieren, im Idealfall schon beim ersten Auftreten.
Aber wie schafft man das?
Indem man sich als Autor zunächst davon verabschiedet, möglichst im ersten Absatz schon eine komplette Personenbeschreibung liefern zu wollen. Weitschweifige Informationen von Haarfarbe bis Schuhgröße taugen für steckbriefliche Fahndungen, beseelen aber keine Romanfigur. Plakative Attribute wie „Sie war eine kluge Frau“ oder „Er sah sehr gut aus“ helfen auch nicht weiter, weil so etwas bloße Behauptungen sind, die erst mit Leben gefüllt werden wollen.
Die Bindung an die Figur stellt sich ein, wenn in ihrem Auftritt ihre Befindlichkeit zum Vorschein kommt. Wenn sich sofort Einblicke in ihren Charakter ergeben, originelle Wesenszüge erkennen lassen. Dann fühlt sich der Betrachter in die Figur ein und sie verliert ihre Künstlichkeit. Wenn das passiert, wird aus der fiktiven Gestalt rasch ein guter Bekannter. Es interessiert einen, wie es mit dem weitergeht.
Ich möchte Ihnen anhand von drei Beispielen zeigen, wie sich eine Romanfigur etablieren lässt. Diese Beispiele sind meinen eigenen Romanen entnommen – nicht, weil ich mich für den Größten meiner Zunft hielte, sondern um urheberrechtliche Querelen zu vermeiden.
Alle drei Beispiele benutzen die äußere Erscheinung der Figur, um sich zu ihrer Persönlichkeit durchzuarbeiten:
„Gertrud Holle rauschte herein wie eine Fregatte unter Volldampf, gefühlte Wasserverdrängung tausend Tonnen. Die Figur tornadosicher mit einer Überdosis Festiger betoniert. Glitzernde Schweinsäuglein unter sorgsam gezupften Brauen. Dezentes Kostüm in Hanseatenblau, Perlenbrosche und Lacktäschchen. Schwer bemüht, bis ins letzte Detail akkurat und ordentlich zu wirken – so ordentlich, dass ich sie am liebsten mit Sagrotan aus der Kulisse gewischt hätte.“
„Eine kleine Person wirbelte herein. Eigentlich ging sie normal geradeaus wie andere Menschen auch. Trotzdem sah es immer so aus, als hielte ein innerer Tornado Merle Striebeck permanent auf voller Drehzahl – hart am roten Bereich. Wahrscheinlich führte diese Binnenrotation zu einer Sogwirkung, die vor allem in Erscheinung trat, sobald Merle ihren Kleiderschrank öffnete. Die Klamotten flogen ihr dann um den Leib wie Eisenfeilspäne an einen Magneten. Anders war die Farb- und Stilkombination ihrer Bekleidung kaum zu erklären. Merle trug grundsätzlich an beiden Füßen unterschiedliche Socken, besaß eine Schwäche für neonfarbene Accessoires und bevorzugte bei Stoffen stets die schrillste Variante. Auch in ihrem momentanen Outfit hätte Merle jederzeit auf der Autobahn eine Nachtbaustelle einrichten können, ohne überfahren zu werden.“
„Vor mir stand plötzlich eine junge Frau. Rote Haare mit einer missglückt eingefärbten Grünsträhne, die gnädigerweise bereits verblasste. Ihre Kleidung stammte offensichtlich nicht aus dem guten Hause eines angesagten Designers und saß nicht besonders gut, was auch an einigen Pfunden Übergewicht liegen mochte, die sie mit sich herum trug. Winzige Fältchen um Mund und Augen erzählten mir, dass sie gerne lachte. Etwas in ihrem Blick besagte, dass es für sie gerade nicht viel zu lachen gab.“
Aus diesen Beschreibungen liest man den Charakter der Figuren. Nummer 1 ist ein berechnender, durchsetzungskräftiger Mensch. Nummer 2 eine anstrengende, chaotische, aber nicht böswillige Persönlichkeit. Nummer 3 signalisiert Widersprüchlichkeiten und Seelentiefe. Das ist in den Beispielpassagen nicht ausdrücklich genannt, aber man spürt es beim Lesen (so hoffe ich zumindest…).
Man kann eine Figur auch einführen, indem man sie etwas tun lässt, was ein Schlaglicht auf ihren Charakter wirft. So etwas funktioniert in Büchern, vor allem aber auch in Filmen sehr gut. Zum Beispiel in so einer Szene:
Ein Mann tritt in eine unaufgeräumte Küche, um sich Kaffee zu kochen. Er sucht in diversen Schränken, findet jedoch keinen. Kurzentschlossen öffnet er den knallvollen Abfalleimer, kramt den benutzten Filter von gestern aus dem Müll und brüht damit neuen Kaffee auf. Schon wissen wir: Dieser Mann führt kein geregeltes Leben, nimmt es jedoch pragmatisch.
Die dritte Möglichkeit einer Figuren- Charakterisierung im Roman oder Film bietet der Dialog. Überlegen Sie sich schon vor Schreibbeginn, welche Art Sprache und welche Sprüche zu Ihrem Romanhelden passen. Dann gelingen Ihnen vielleicht auch so stimmige Dialoge wie die im Film-Klassiker „Casablanca“, mit denen sich der von Humphrey Bogart gespielte Nachtclubbesitzer Rick Blaine sich sofort als unerschütterlicher Zyniker etabliert:
„Welche Nationalität haben Sie?“
Antwort Blaine: „Ich bin Trinker.“
Oder: „Vergessen Sie nicht, die Pistole ist genau auf Ihr Herz gerichtet.“
Antwort Blaine: „Da bin ich am wenigsten verwundbar.“
Fehlen Ihnen zunächst die Worte, räumen Sie sich mehr Zeit dafür ein, Ihre Sprache zu finden. Es gibt so unfassbar viele unterschiedliche Beschreibungsmöglichkeiten für alles und jeden. Wenn Sie lange genug darüber nachdenken, finden Sie für jedes Bild, jede Empfindung, jede Figur eine Formulierung, die Ihrer schöpferischen Absicht entspricht und mit der Sie sich wohl fühlen. Ist das noch nicht ganz der Fall, lohnt es sich immer, noch ein wenig länger darüber nachzudenken, denn:
Nichts und niemand ist unbeschreiblich.
Diese Regel stammt aus dem Tatort-Schreibtisch-Buch:
Jan Schröters "Goldene Schreibregeln" - 22 Tipps für Autoren und alle, die es werden wollen
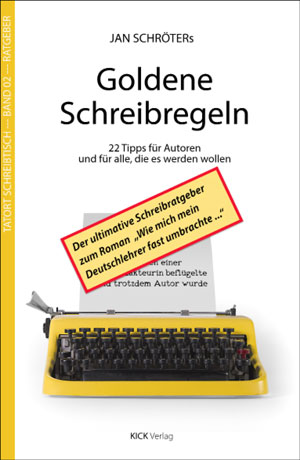
Wenn Sie das Buch bestellen möchten, schicken wir Ihnen das Buch versandkostenfrei zu.
Mailen
Sie uns einfach Ihre Bestellung zusammen mit Ihrer Anschrift und Ihrer
Kontoverbindung (IBAN) zu, wir buchen den Rechnungsbetrag von Ihrem
Konto ab. Alternativ bekommen Sie von uns eine Rechnung, damit Sie uns
den Betrag überweisen können.
E-Book ohne Anmeldung kaufen
Autorenportrait von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
weiterlesen
weniger
