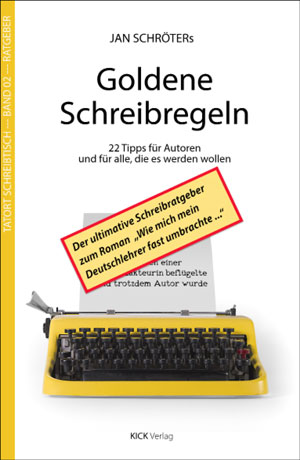Herzlich willkommen!
Sie schreiben ein Buch oder ein Theaterstück? Sie arbeiten an einem Drehbuch oder an einer Kurzgeschichte? Glückwunsch! Schreiben ist eines der schönsten Dinge der Welt! Aber es ist auch eine der einsamsten und schwierigsten Beschäftigungen, wenn man alleine vor seinem Text sitzt, ohne Hilfe, ohne Unterstützung.Das will Tatort-Schreibtisch ändern!
Von den Profis lernen – das ist die Logline unserer Autoreninitiative. Erfahrene und erfolgreiche Schreib-Profis berichten auf dieser Webseite von ihrer Arbeit und verraten Ihnen Tipps und Tricks, mit denen Sie auf dem Buchmarkt oder im Drehbuchgeschäft erfolgreich sind.
weiterlesen

Profiautoren als Ratgeber
Hilfe durch das Autorenpaten-Programm
Im Autorenpaten-Programm von Tatort-Schreibtisch haben Sie die Möglichkeit, sich für Ihr aktuelles Schreibprojekt eine professionelle Autorin oder einen erfolgreichen Autor als Ratgeber an Ihre Seite zu holen. Das Angebot reicht vom Info-Gespräch über die fachliche Einschätzung Ihres Manuskriptes bis zur Beratung bei Ihrer Verlags- oder Agentur-Bewerbung. Alle Autorenpaten sind erfahrene Schreib-Profis, die ihre Texte erfolgreich in Verlagen veröffentlichen, häufig preisgekrönt sind und z.T. auch als Dozenten lehren. Tatort-Schreibtisch ist Partner von Woobooks. weiterlesen

Autorenpate der Woche
Peter Gerdes ist „Mr. Mordwesten“. Seit gut zwanzig Jahren schreibt der Ostfriese Kriminalromane und Kurzkrimis,...
Peter Gerdes
Autorenpate für ProsaPeter Gerdes ist „Mr. Mordwesten“. Seit gut zwanzig Jahren schreibt der Ostfriese Kriminalromane und Kurzkrimis,...
weiterlesen

Tatort der Woche
Das Wichtigste in meiner Schreibhöhle ist der Schreibtisch selbst: ein massives Teil aus den 1920er Jahren aus einer Wiener Schulbehörde. Seit ich den Tisch habe, macht das Schreiben noch mehr Spaß. Darüber passend eine Lampe aus den 30ern. Selbst der Mülleimer...
Schreibhöhle mit Hund
von Raoul BiltgenDas Wichtigste in meiner Schreibhöhle ist der Schreibtisch selbst: ein massives Teil aus den 1920er Jahren aus einer Wiener Schulbehörde. Seit ich den Tisch habe, macht das Schreiben noch mehr Spaß. Darüber passend eine Lampe aus den 30ern. Selbst der Mülleimer...
weiterlesen
Frage der Woche

Ich habe einen tollen Titel für mein neues Buch gefunden. Wie erfahre ich, ob es den Titel schon gibt? Wie kann ich meinen Titel schützen?
von Markus Stromiedel
Der Titelschutz ist in Deutschland nach dem Markengesetz geregelt (§5 + 15). Er ensteht, wenn
1.) das Werk erscheint, also als Buch oder E-Book erhältlich ist, oder
2.)
wenn eine Titelschutz-Anzeige veröffentlicht wird, in branchenüblicher
Weise, also mit dem Ziel, dass die Branche davon erfährt. Das kann z.B.
eine gedruckte Anzeige im Börsenblatt sein, dem Verbandsorgan des
Börsenvereins des Buchhandels, aber auch eine Titelschutz-Anzeige im
Internet ist möglich...
weiterlesen
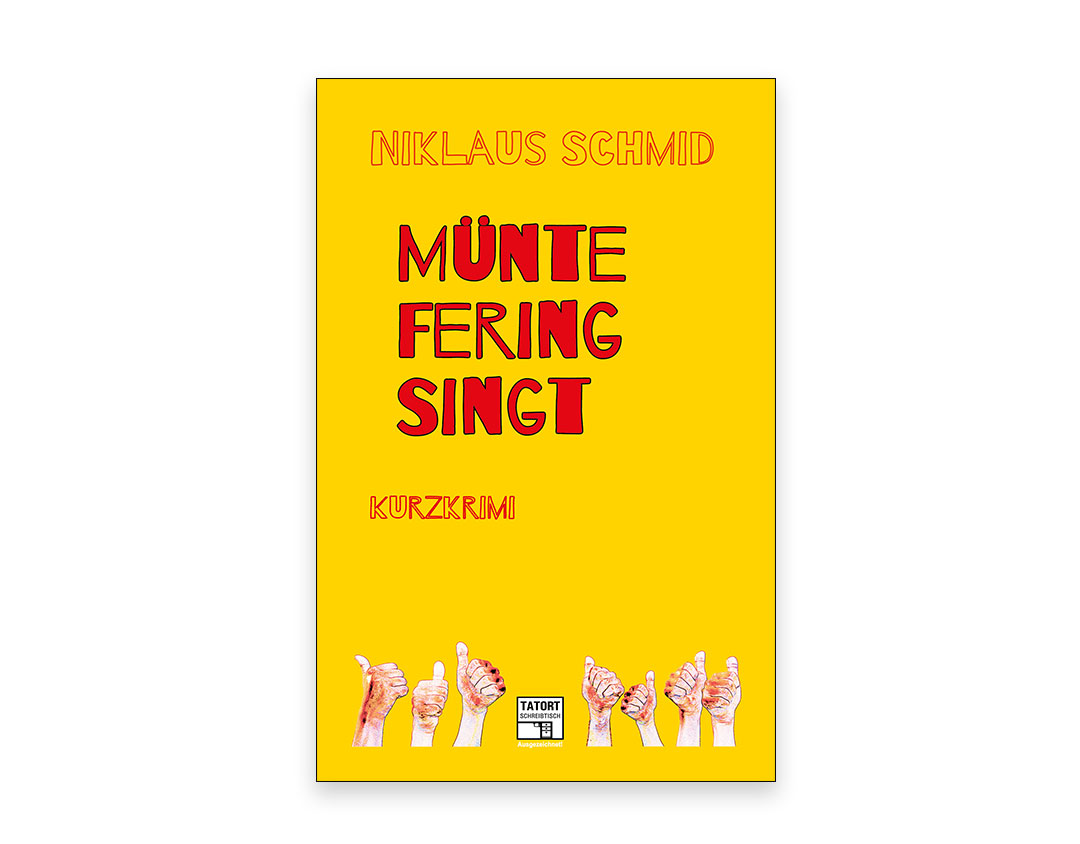
Tatort-Schreibtisch-Buch der Woche
Niklaus Schmid: "Müntefering singt"
Feinkostläden statt Aldi, Malediven statt Baggersee. Mit Hartz IV ist das nicht drin. Doch Ellie hat einen Plan: Wir schnappen uns einen Promi und fordern Lösegeld. Kleinganove Ulf hat Bedenken, Leibwächter und so... weiterlesen
Schreibregel der Woche

© Autorenfoto: Hocky Neubert
Stellen wir uns vor, Sie hätten nicht mehr alle Latten am Zaun. Angesichts Ihres eventuell gehegten Vorhabens, als Autorin oder Autor reich und berühmt zu werden oder wenigstens mit dem Schreiben den Lebensunterhalt verdienen zu wollen, könnten Ihre Mitmenschen durchaus zu so einem Urteil gelangen. Aber damit beschäftigen wir uns in der Schreibregel Nr. 16. Hier und jetzt ist es wörtlich gemeint...
Beachte die Rechtschreibung – sonst nimmt man weder die Botschaft noch den Verfasser für voll
von Jan Schröter
© Autorenfoto: Hocky Neubert
Stellen wir uns vor, Sie hätten nicht mehr alle Latten am Zaun. Angesichts Ihres eventuell gehegten Vorhabens, als Autorin oder Autor reich und berühmt zu werden oder wenigstens mit dem Schreiben den Lebensunterhalt verdienen zu wollen, könnten Ihre Mitmenschen durchaus zu so einem Urteil gelangen. Aber damit beschäftigen wir uns in der Schreibregel Nr. 16. Hier und jetzt ist es wörtlich gemeint...
weiterlesen

Autoren live: Tatort-Schreibtisch-Hörbuch der Woche
Isabella Archan: "Tote haben kein Zahnweh"
Dr. Leocardia Kardiff, Zahnärztin mit Spritzenphobie, wird in den Mord an einer betuchten Witwe verwickelt. Von Neugierde und Gerechtigkeitssinn getrieben, macht sie sich auf die Suche nach dem Täter... weiterlesen

Tatort-Schreibtisch-Autor der Woche
Kennengelernt habe ich Uwe bei der Berlinale Anfang der neunziger Jahre. Ich war kurz davor, ein Studium zu beginnen, hatte mit meinem Drehbuch-Co-Autor Peter Scheerer bereits einige Kurzfilme gedreht und schrieb für ein lokales Magazin über Film. Wir waren hungrig und besessen davon, in die Filmindustrie reinzukommen, aber hatten keinerlei Kontakte und waren wie alle Studenten knapp bei Kasse.
Uwe Boll: Furchtlos, gradlinig und gnadenlos offen
Ein Autorenportrait von Michael RoeschKennengelernt habe ich Uwe bei der Berlinale Anfang der neunziger Jahre. Ich war kurz davor, ein Studium zu beginnen, hatte mit meinem Drehbuch-Co-Autor Peter Scheerer bereits einige Kurzfilme gedreht und schrieb für ein lokales Magazin über Film. Wir waren hungrig und besessen davon, in die Filmindustrie reinzukommen, aber hatten keinerlei Kontakte und waren wie alle Studenten knapp bei Kasse.
weiterlesen

Exklusiv nur bei "Tatort-Schreibtisch":
Bücher kostenlos lesen und hören
"Tatort Schreibtisch" ist eine Initiative des Kick-Verlages, der sich der Leseförderung von Kindern und Jungendlichen sowie der Autorenförderung verschrieben hat. Im Rahmen dieser Förderprogramm ermöglicht "Tatort Schreibtisch" auf seinen Webseiten, alle Bücher aus seinem Programm kostenlos zu lesen und zu hören.
Um dieses exklusive und einmalige Angebot anzunehmen, brauchen Sie nur ein kostenloses Tatort-Schreibtisch-Konto zu eröffnen, um sofort danach auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Computer alle Bücher und Hörbücher lesen zu können. Die ersten 40-50 Seiten oder die ersten 45-60 Minuten sind immer kostenlos, danach werden Sie gebeten, von "Tatort Schreibtisch" z.B. auf ihrem Social Media Account zu berichten, als Dankeschön schalten wir Ihnen weitere Abschnitte des jeweiligen Buches frei.
Hör- und Lesestoff finden Sie hier:

Fragen und Antworten - sofort!
Facebook-Gruppe bietet Forum für den direkten AustauschMitglieder der Facebook-Community haben ab sofort die Möglichkeit, mit vielen der Autorenpaten aus dem Tatort-Schreibisch-Patenprogramm direkt in Kontakt zu treten. In der Gruppe "Autoren-Tipps und Tricks" können Schreib-Interessierte Fragen stellen, die von den Profi-Autoren und -Autorinnen beantwortet werden.
Hier geht es zur Facebook-Gruppe

Eine Bühne für Ihre Projekte
Hier geht es zur Tatort-Schreibtisch-Community
Entdecken Sie die Community von Tatort-Schreibtisch
Tatort-Schreibtisch ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Texte mit Hilfe von Profis weiterentwickeln können. Die Tatort-Schreibtisch-Community bietet allen Teilnehmern der Autorenpaten-Programme ein Forum, Ihre Projekte interessierten Verlagen und Redaktionen vorzustellen. Dies ist ein kostenloses Angebot von Tatort-Schreibtisch (das Sie in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen). Auf den Seiten der Community finden Sie außerdem Erfahrungsberichte von Teilnehmern, die das Autorenpaten-Programm erfolgreich abgeschlossen haben.Hier geht es zur Tatort-Schreibtisch-Community